In der vor Kurzem (= März 2017) geführten Diskussion um die Kostenübernahme für homöopathische Therapien durch die gesetzlichen Krankenkassen verwies der Pressesprecher des DZVhÄ auf die Ergebnisse der homöopathischen Versorgungsforschung. Diese zeigten angeblich, so steht es im letzten hier auf dem Blog noch zu betrachtenden Teil des Forschungsreaders der WissHom, dass die Wirksamkeit der Homöopathie unter Alltagsbedingungen der konventionellen Medizin gleichkommt. Ein Fehlschluss, wie sich bei genauerer Betrachtung zeigt.
In Kürze
Das, was die Homöopathen als Versorgungsforschung bezeichnen, ist keine. Forschungsgegenstand ist eben nicht die Versorgungssituation, also Strukturen und Methoden, die erforderlich sind, die Therapie in der Bevölkerung flächendeckend erfolgreich anzuwenden. Es geht vielmehr um die Frage, ob und in welchem Ausmaß eine homöopathische Therapie wirksam ist, was im normalen Gesundheitswesen keine Frage der Versorgungsforschung wäre. Offenbar fasst man in der Homöopathie Beobachtungsstudien generell als Versorgungsforschung auf, völlig unabhängig vom Untersuchungsgegenstand.
Beobachtungsstudien können aus prinzipiellen Gründen keine belastbare Evidenz liefern, denn bei diesem Studiendesign können Störgrößen nur unzureichend kontrolliert werden. Dies mag ein Grund dafür sein, dass in Beobachtungsstudien die Ergebnisse für die Homöopathie üblicherweise besser ausfallen als in kontrollierten Vergleichsstudien. Dies macht sie zu einem geeigneten Instrument des Marketings und der Werbung, insbesondere bei einem im wesentlichen unkundigen Publikum, dem die positiven Ergebnisse präsentiert werden, das aber die methodischen Vorbehalte nicht einzuordnen weiß – insbesondere, wenn sie, wie im Forschungsreader, auch noch unsachgemäß dargestellt werden.
Dass die von den Homöopathen aus den Beobachtungsstudien gezogenen positiven Schlussfolgerungen auch infolge weiterer Unzulänglichkeiten in keiner Weise gerechtfertigt sind, zeigt ein kleiner Streifzug durch die im Forschungsreader positiv dargestellten Studienergebnisse.
In Länge
In den letzten Wochen wurde viel über Sinn und Unsinn diskutiert, ob die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Homöopathika und homöopathische Therapien übernehmen sollten. Natürlich sollten sie das, meint der Pressesprecher des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte (DZVhÄ), Björn Bendig [1]. Schließlich zeige die Versorgungsforschung ja deutlich auf, dass Homöopathika im Alltag eine wesentlich bessere Wirksamkeit entfalteten als in placebokontrollierten Studien. Dies könne man dem Forschungsreader entnehmen, der im letzten Jahr von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie publiziert wurde [2]. In dem dort enthaltenen Artikel zur Versorgungsforschung in der Homöopathie kommt Michael Teut zu dem Ergebnis [3]:
„Die Studien aus der Versorgungsforschung zeigen in der Summe ein relativ einheitliches Bild: Bei Patienten, die sich homöopathisch behandeln, treten im klinischen Alltag relevante Verbesserungen auf, ähnlich stark ausgeprägt wie in der konventionellen Therapie, allerdings mit weniger Nebenwirkungen und in der Hälfte aller ökonomischen Studien mit geringeren Kosten.“
Zwar könne daraus aus methodischen Gründen nicht geschlossen werden, dass sich die Wirksamkeit der Homöopathika von Placebo unterscheide, heißt es da durchaus zutreffend. Aber was versteht der zumeist nicht fachkundige Leser des Forschungsreaders unter „methodischen Gründen“, wenn dann dreißig und mehr angeblich erfolgreiche Studien, das heißt positive Studienergebnisse, aufgezählt werden?
Der Leser wird die Botschaft aufnehmen, dass es für die Homöopathie vorteilhafte Forschungsergebnisse gibt – und sich keinen Deut damit beschäftigen, wie die Forschungsdisziplin nun genau heißt, unter der die Resultate aufgetreten sind. Forschung ist zunächst erst einmal Forschung. Aus der homöopathischen Versorgungsforschung wird so unversehens die Alternative, der gefühlte klinische Wirksamkeitsnachweis.
Versorgungsforschung in der konventionellen Medizin
In der Tat, da haben die Homöopathen durchaus Recht, wird in der Versorgungsforschung betrachtet, welche Ergebnisse eine Therapie in der realen Umwelt zeigt. In einer kontrollierten Vergleichsstudie geht es um die quasi unter Laborbedingungen feststellbare Wirksamkeit, bei der die Homöopathie zumeist nicht so gut abschneidet.
Gegenstand der Untersuchung ist zwar ebenfalls der Nutzen für die Patienten, aber der Schwerpunkt liegt nicht auf der Therapie selbst, sondern auf den Bedingungen, die gegeben sein müssen, dass die positiven Wirkungen auch flächendeckend bei der Bevölkerung ankommen. (Edit: Text aufgrund des Kommentars von Joseph Kuhn angepasst.) Sind die Ärzte hinreichend ausgebildet? Sind die Patienten hinreichend informiert? Sind die Heil- und Hilfsmittel in der richtigen Menge an der richtigen Stelle vorhanden? Gibt es überhaupt genügend Therapieplätze? Werden diese angenommen? Ist den Patienten die Bedeutung einer strikten Einhaltung der Einnahmevorschriften bewusst? Und vieles mehr. Natürlich ist auch die Frage nach den Kosten gegeben: Sind diese durch den Nutzen gerechtfertigt? Können sie von den Kostenträgern überhaupt aufgebracht werden?
Auch das beste Medikament oder die sicherste Therapie nutzt nichts, wenn es an der Umsetzung fehlt. Daher ist die Versorgungsforschung ein zwar wenig bekanntes, aber dennoch wichtiges Aufgabengebiet im Gesundheitswesen, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Webseite schreibt [4].
Es gibt eine interessante, öffentlich zugängliche Datenbank des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung, in der man sich sehr detailliert über öffentlich geförderte Projekte informieren kann [5]. Die Projekte sind sehr ausführlich beschrieben, welche Fragestellung untersucht wird, welche Ziele damit verfolgt werden, etc. Hier kann man sich umschauen und feststellen, mit welchen Fragestellungen man sich beschäftigt.
Ein paar wahllos herausgegriffene Beispiele sollen illustrieren, worum es geht:
In einem Projekt „Verbesserung der Versorgung und Kooperation mit Nephrologen bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion in der Hausarztpraxis“ sollen offensichtliche an der Schnittstelle zwischen Hausarzt und Nephrologie (= Nierenheilkunde) bestehende Probleme untersucht und eine Leitlinie erstellt werden [6].
Im Klinikum der Universität München wurde nach englischem Vorbild eine Atemnotambulanz eingerichtet, in der Patienten mit Atemnot infolge eines fortgeschrittenen Krankheitsstadiums (Krebs, COPD etc.) behandelt werden. In diesem Projekt wird der erreichte Effekt dieser neuen Einrichtung untersucht [7].
In einer anderen Studie geht es um die Frage, ob die vorhandene S3-Leitlinie bei der Behandlung von Depressionen wahrgenommen und befolgt wird und was dies für Folgen für die Patienten hat [8]. Im Vergleich zu früheren Daten soll festgestellt werden, ob sich nach der Einführung der Leitlinie die Situation gebessert hat.
Es geht mithin nicht um die Wirksamkeit von Therapiemaßnahmen an sich, sondern um die Frage, ob sie auf die richtige Art und Weise an den Mann oder an die Frau gebracht werden. „Was muss getan werden, damit die Bevölkerung von der Therapie XY profitiert?“ Diese Fragestellung macht natürlich nur Sinn, wenn es etwas umzusetzen gibt oder wenn der Mangel an geeigneten Verfahren aufgezeigt werden soll.
Homöopathische Versorgungsforschung
Im Vergleich dazu einige der Fragestellungen, die in den Arbeiten untersucht werden, die nach Ansicht der Homöopathen der Versorgungsforschung zuzurechnen sind:
„Das Ziel dieser Studie war, die Wirksamkeit der Homöopathie bei akuten Atemwegs- und Ohrbeschwerden im Vergleich zur konventionellen Therapie in der Erstversorgung zu untersuchen.“ [9]
„Viele Krebspatienten nutzen die Homöopathie als Zusatzbehandlung. Es ist bislang selten systematisch untersucht worden, ob eine homöopathische Behandlung dem Patienten nutzt.“[10]
„Das Ziel dieser Studie bestand darin, zu evaluieren, ob die Homöopathie den globalen Gesundheitszustand und das subjektive Wohlbefinden beeinflussen kann, wenn sie als Additiv zur konventionellen Krebstherapie angewandt wird.“ [11]
Diese Fragestellungen haben nichts mit Versorgungsstrukturen zu tun! Das sind reine klinische Fragestellungen: Welchen Nutzen zieht ein Patient aus einer homöopathischen Behandlung? Welchen Einfluss hat diese auf seine Gesundheit? Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Versorgungsforschung zu tun. In der homöopathischen Versorgungsforschung wird nicht gefragt, wie man die Homöopathie in die Fläche bringt, sondern ob sie überhaupt eine Wirkung hat, und wenn ja, wie stark diese ist. Es handelt sich also reinewegs um Beobachtungsstudien, die zur Untersuchung der Wirksamkeit durchgeführt werden – und wir können sie daraufhin betrachten, ob sie tatsächlich die behauptete Evidenz liefern.
Ganz offenbar unterscheidet man beim DZVhÄ und in anderen Homöopathie-Organisationen zwischen klinischer Forschung, gekennzeichnet dadurch, dass man kontrollierte Vergleichsstudien durchführt, und Versorgungsforschung, die auf Beobachtungsstudien aufbaut. Wenn diese Vermutung tatsächlich zutrifft, dann gilt sie allerdings nur im Sprachgebrauch der Homöopathen. In der konventionellen Medizin hingegen werden auch Beobachtungsstudien mit klinischen Fragestellungen zur Untersuchung der Wirksamkeit eines Verfahrens ausgeführt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine randomisierte Vergleichsstudie nicht möglich ist.
Als Beispiel: Würde man die Wirksamkeit von Schutzimpfungen mittels einer kontrollierten Vergleichsstudie nachweisen wollen, müsste man Patienten nach einem Zufallsprinzip impfen oder ein Placebo verabreichen und dann einem Infektionsrisiko aussetzen. Dem würde wohl keine Ethikkommission der Welt zustimmen, und es dürfte auch schwierig sein, Patienten zu finden, die sich angesichts des Risikos diesem Test zur Verfügung stellen. Man kann nicht anders, als die gesundheitliche Entwicklung der Gruppen betrachten, die sich dadurch freiwillig bilden, indem sich die Menschen für eine Impfung entscheiden oder nicht.
Die Konsequenz ist natürlich, dass der Grad der Evidenz nicht besonders hoch ist – aber besser als nichts – und die Impfgegner im obigen Fall durchaus mit einiger Berechtigung darauf hinweisen können, dass die Wirksamkeit des Impfschutzes nicht klinisch nachgewiesen sei.
Aber zurück zur Homöopathie: Warum fassen die Homöopathen ihre Beobachtungsstudien unter dem Oberbegriff der Versorgungsforschung zusammen und behaupten, sie hätten etwas anderes durchgeführt als klinische Forschung? Die naheliegendste Erklärung ist wohl die, dass man vermeiden will, über die Stärke der Evidenz zu diskutieren, indem man diese Studien nicht als Wirksamkeitsnachweis bezeichnet. Dem Laien, der den Reader liest, dürften diese feinsinnigen Unterschiede gleichgültig sein, ihm bleibt die Aufzählung der vielen positiven Ergebnisse im Gedächtnis – und er interessiert sich nicht dafür, unter welcher Überschrift das steht, ob das Versorgungsforschung oder sonstwie heißt. Der Kritiker hingegen kann damit beruhigt werden, dass man ja auf die fehlende Höhe der Evidenz hingewiesen hat, womit sich seine Kritik doch eigentlich erübrigt.
Marketing eben.
Beobachtungsstudie versus kontrollierte Vergleichsstudie
Seitens der Homöopathen wird gerne das Argument angeführt, eine placebokontrollierte Studie wäre für die Ermittlung der Wirksamkeit homöopathischer Therapien wegen der starken Individualisierung nicht geeignet. Bei den Beobachtungsstudien indes sei das ganz anders, diese bildeten die Situation in der täglichen Praxis viel besser ab, weshalb die Homöopathie in einem solchen Studiendesign in den allermeisten Fällen viel besser abschneide. Dies stimme auch mit der Erfahrung der homöopathischen Therapeuten wesentlich besser überein als die oftmals unvorteilhaften Ergebnisse der kontrollierten Vergleichsstudien.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Beobachtungsstudie und einer placebokontrollierten Vergleichsstudie? Was ist es denn, was sie besser geeignet erscheinen lässt, die homöopathische Therapie zu erproben?
Eine randomisierte placebokontrollierte verblindete Vergleichsstudie (nach der englischen Bezeichnung PCT) zeichnet sich dadurch aus, dass, wie der Name sagt,
- eine Vergleichsgruppe gebildet wird, die eine Therapie bekannter Wirksamkeit erhält, oftmals in Gestalt eines wirkstofffreien Placebos,
- die Zuordnung der einzelnen Patienten zu den Gruppen per Zufall erfolgt,
- den Patienten und das betreuende Pflege- und Studienpersonal über die Gruppenzuordnung im Unklaren sind.
Die Patienten werden anhand im Studienprotokoll festgelegter Ein- und Ausschlusskriterien ausgewählt, damit das untersuchte Krankheitsbild möglichst einheitlich bei allen Patienten vorliegt. Die Therapie erfolgt entsprechend bis auf den Unterschied, ob Placebo oder zu testendes Mittel verabreicht wird, für alle Patienten gleich.
Dieses Vorgehen ist auch für die Homöopathie möglich, indem der Therapeut das Mittel festlegt, bei der Zusammenstellung der Rationen für die Patienten jedoch nach einem Zufallsprinzip entweder das bestimmte Mittel oder eben Placebo gegeben wird. Solche Studien gibt es in beträchtlicher Zahl, wie man der systematischen Übersichtsarbeit von Mathie aus dem Jahr 2014 entnehmen kann [12]. Dort wurden über 30 solcher Studien betrachtet.
Was ist bei den Beobachtungsstudien anders?
Die zielgerichtete Untersuchung der Wirkung einer homöopathischen Therapie bei bestimmten Krankheitsbildern gibt es bei den im Reader aufgeführten Beobachtungsstudien auch. Rostock untersucht Krebspatienten, Frass ebenfalls, Haidvogl akute Erkältungskrankheiten und Ohrbeschwerden, Pomposelli untersucht Polyneuropathie als Folge von Diabetes und so weiter und so fort. Das heißt, es werden viele klinische Fragestellungen untersucht, die prinzipiell einer randomisierten Vergleichsstudie ebenfalls zugänglich wären.
Prinzipiell gibt es in der homöopathischen Versorgungsforschung Beobachtungsstudien mit und ohne Kontrollgruppe. Sofern eine solche im Studiendesign vorgesehen ist, wird sie zumeist dadurch gebildet, dass Patienten, die sich für eine homöopathische Therapie entschieden haben, mit solchen verglichen werden, die sich einer konventionellen Behandlung unterziehen. Es fehlt mithin gegenüber einer PCT an der Randomisierung und der Verblindung. Das ganze Therapiesetting hingegen ist prinzipiell das gleiche. Allerdings kann der Patient im Gegensatz zu einer PCT sicher sein, dass er die Behandlung erhält, die er sich ausgesucht hat, was auch bedeutet, dass er nicht das Risiko eingeht, mit einem Placebo behandelt zu werden.
Das hat gewisse Folgen. Durch die fehlende Randomisierung ist nicht sichergestellt, dass in den Gruppen die gleiche Ausgangssituation herrscht. Denkbar wäre etwa, dass die Patienten sich nach gewissen Kriterien, beispielsweise der Heftigkeit der Beschwerden, für die eine oder andere Therapie entscheiden. Es wäre etwa vorstellbar, dass sich Patienten mit einer normalen alltäglichen Erkältung eher dem Homöopathen zuwenden, Patienten, bei denen zusätzlich Fieber auftritt, vielleicht vermehrt zum „richtigen“ Arzt gehen.
Weiterhin ist durchaus denkbar, dass die Homöopathie nur als Zusatztherapie angewandt wird. Wenn es nichts nutzt, dann wird es auch nichts schaden. Selbst wenn eine Vergleichsgruppe gebildet wird, ist folglich nicht sichergestellt, dass die Gruppen auch hinsichtlich der Art der Erkrankung bzw. deren Schwere vergleichbar sind. Da die Homöopathie stark an den Symptomen orientiert ist, wird bei der Studie zwar häufig die Intensität der Symptome bei beiden Gruppen abgefragt und miteinander verglichen, was aber nicht bedeutet, dass die Patienten beider Gruppen unter den gleichen Erkrankungen leiden.
Der zweite Punkt ist die fehlende Verblindung. Das Studienpersonal hat in der Regel eine positive Haltung zur Homöopathie – sonst würde es die Studie nicht durchführen – und weiß auch recht genau, in welche Richtung positive Ergebnisse weisen müssen. Damit ist es gut möglich, dass man bewusst oder unbewusst das Ergebnis beeinflusst, was durch ein striktes Studiendesign ausgeschlossen werden müsste. Wichtig wäre beispielsweise, dass die Abfrage des Erfolgs beim Patienten nicht durch die Therapeuten erfolgt, sondern durch an der Studie ansonsten unbeteiligte Interviewer, die selbst wiederum nicht wissen, womit der abgefragte Patient behandelt wurde.
Diese bisher aufgeführten Punkte sind aber aus Sicht des Patienten nur Randbedingungen, die den Verlauf der Therapie nicht tangieren. Der Patient erhält in einer Beobachtungsstudie genau wie in einer PCT eine homöopathische Therapie bzw. eine konventionelle – nur weiß er, dass das so ist, und er hat sich auch selbst dafür entschieden.
Ein wesentlicher Aspekt dieses Studientyps ist die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes. Wie stellt man fest, ob es überhaupt die Homöopathie war, die die Änderungen beim Patienten herbeigeführt hat? Der Patient hat ein Problem, geht damit zum Homöopathen und erlebt im günstigen Fall eine Linderung seiner Beschwerden. Was aber war es wirklich, das zu dieser erfreulichen Entwicklung geführt hat? Was hat der Therapeut alles gemacht? Vielleicht weitere Behandlungen ausgeführt? War überhaupt die Konsultation des Homöopathen das Einzige, was der Patient getan hat? Oder war die Hömöopathie nur eine Maßnahme unter mehreren, gar nur eine zusätzliche Möglichkeit, parallel zur konventionellen Medizin?
In der Beobachtungsstudie – insbesondere beim vollständigen Fehlen einer Vergleichsgruppe – kann das nicht unterschieden werden. Das hindert die Autoren, noch viel weniger diejenigen, die die Arbeiten zitieren, nicht daran, die Erfolge einzig und allein der Homöopathie zuzuschreiben – und sei es auch nur dadurch, dass die Ergebnisse entsprechend dargestellt werden, dass der unkundige Leser beispielsweise eines Forschungsreaders diesen Schluss selbst zieht.
Dabei haben wir noch nicht von unspezifischen Effekten gesprochen, beispielsweise der Regression zur Mitte oder dem vielfach angeführten Placeboeffekt. Es gibt mithin eine ganze Reihe Störgrößen, die in einer PCT durch das Studiendesign möglichst ausgeschlossen werden, und die das Ergebnis in einer Beobachtungsstudie in die positive Richtung beeinflussen könnten.
Was macht also in der Zusammenfassung den Studientyp der Beobachtungsstudie so viel geeigneter für die Untersuchung der Homöopathie als die kontrollierte Vergleichsstudie?
- Die Patienten erhalten ihre Wunschtherapie, was einen Placeboeffekt hervorrufen kann.
- Das Studienpersonal wird wahrscheinlich das Ergebnis nach Kräften fördern, was nur durch ein entsprechendes Studiendesign begrenzt werden kann.
- Die Erfolge können der Homöopathie zugeschrieben werden, auch wenn sie eigentlich durch andere Vorgänge verursacht wurden.
- Gleiches gilt für die Folgen der unspezifischen Effekte, die ebenfalls der Homöopathie zugerechnet werden und die sich bei den sehr wahrscheinlich unterschiedlichen Voraussetzungen von Homöopathie- und Vergleichsgruppe kaum ermitteln lassen, wenn eine solche überhaupt gebildet wurde.
Quintessenz: Die Beobachtungsstudie bietet jede Menge Möglichkeiten, dass Dinge der Wirkung der Homöopathie zugeschrieben werden, die damit nichts zu tun haben. Bei einer PCT geht das weniger. Kein Wunder, dass die Ergebnisse von Beobachtungsstudien besser sind als die von PCTs – was die Beliebtheit der „homöopathischen Versorgungsforschung“ hinreichend erklären dürfte.
Beobachtungsstudien in der Homöopathie
Teut zählt über dreißig angeblich für die Homöopathie erfolgreiche Beobachtungsstudien auf, natürlich nicht ohne den Hinweis, dass kausale Schlussfolgerungen auf die Wirksamkeit der Therapie nicht möglich sind. Interessant sind die Gründe, die angeführt werden: Die Ergebnisse könnten durch den sozialen Status, das Einkommen, den Lebensstil oder Begleittherapien beeinflusst sein. Nun ja, man nennt dies wohl ein Strohmann-Argument. Die genannten Gründe erscheinen abgesehen von den Begleittherapien dem uneingeweihten Leser wohl eher weniger bedeutsam – die wesentlich entscheidenderen Probleme dieses Studiendesigns, siehe oben, werden nicht angeführt.
(Edit: Formulierung nach Kommentar vion Michael Kuhn angepasst.)
Man fragt sich auch, wie der Leser das verstehen wird, dass keine „kausalen“ Schlussfolgerungen möglich sind. Gibt es andere Arten von Schlussfolgerungen? Bei so vielen positiven Ergebnissen? Vielleicht „konditionale“?
Dabei haben die angeblich positiven Ergebnisse bei näherer Betrachtung kaum Bestand und die Angaben von Teut sind recht unvollständig und verzerren das Bild. Daher sollen ein paar der Studien kommentiert werden:
Studien von Witt et al. (Ref 1 – 10 bei Teut) [13]
Das ist die bislang größte und längste Beobachtungsstudie zur Homöopathie, quasi das Paradepferd. Insgesamt fast 4000 Homöopathie-Patienten wurden bis zu acht Jahre lang regelmäßig nach ihrem Befinden befragt. Es ergab sich im Laufe dieser Zeit, schreibt Teut, eine Reduktion der Beschwerdeintensität der Symptome im Mittel um fast die Hälfte sowie eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.
Wie schreibt Cornelia Bajic, Vorsitzende des DZVhÄ auf ihrer Praxis-Webseite [14]?
„Homöopathie hilft bei allen Krankheiten, die keiner chirurgischen oder intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. Ein sorgfältig ausgewähltes Arzneimittel heilt schnell, sanft, sicher, nebenwirkungsfrei und dauerhaft auch schwere, akute und chronische Erkrankungen … für die sonst nur Linderung, aber keine Heilung möglich ist. Dies gilt auch für akute Krankheiten bakterieller und viraler Natur.“
Selbst wenn man die Ergebnisse von Witt in vollem Umfang als gültig ansehen würde, bleibt doch eine merkliche Kluft zwischen Anspruch und belegbaren Ergebnissen. „Schnell“ und „dauerhaft“ sind wohl eher nicht die Attribute, die sich einem aufdrängen, wenn nach acht Jahren die Hälfte der Patienten immer noch unter ihren Beschwerden leiden.
Was Teut hingegen nicht schreibt:
- Während der Beobachtungszeit konsultiert etwa die Hälfte der Patienten noch konventionelle Ärzte (ohne Zahnärzte und Gynäkologen).
- Knapp die Hälfte der Patienten nimmt zu Anfang zusätzlich konventionelle Arzneimittel ein, am Ende immer noch ein Viertel führen also Begleittherapien aus.
- Nur bei einem Viertel der Patienten waren die ursprünglichen Symptome verschwunden.
- Der mittels eines Fragebogens erhobene Index der Lebensqualität stieg auf der physischen Skala von 46,4 auf 50,7 Punkte, auf der psychischen Skala von 39,3 auf 46,4 Punkte, was sicher prozentual ein fühlbarer Anstieg ist. Allerdings relativiert sich das stark, wenn man weiß, dass die Durchschnittswerte in Deutschland, also Kranke und Gesunde zusammen, bei ca. 72,3 bzw. 82,6 Punkten liegt [15]. Die Patienten haben bestenfalls einen Schritt in die richtige Richtung getan. Mehr nicht.
Quintessenz: Dieses Ergebnis ist eher mager und ohne Vergleichsgruppe auch nicht zu bewerten. Man hat zwar in einer späteren Veröffentlichung untersucht, ob es sich bei den Verbesserungen um einen Effekt der Regression zur Mitte handeln könnte [16]. Man fand – o Wunder! – heraus, dass dies nicht als alleinige Erklärung für den Effekt ausreichen würde. Schön, aber es gibt ja auch eine ganze Menge anderer Einflüsse, die dieses Ergebnis herbeigeführt haben könnten, siehe oben.
Aus dieser großen Studie von Witt sind einige weitere Veröffentlichungen zu verschiedenen Krankheitsbildern hervorgegangen, alle von Teut aufgezählt, für die aber prinzipiell die gleichen Vorbehalte gelten.
Andere Arbeiten:
In der Arbeit von Haidvogl (Ref. 12 bei Teut) [9] ging es um ganz banale Erkältungsbeschwerden, wie man hier im Blog nachlesen kann: Index der Intensität je nach Beschwerden 0,9 bis 1,9 auf einer Skala von 0 bis 5. Als Hauptkriterium wurde der Behandlungserfolg nach 14 Tagen gewertet, nach einer Zeit also, nach der solche Beschwerden üblicherweise weitestgehend ausgestanden sind, selbst ohne Therapie. Kein Wunder also, dass die homöopathisch und die konventionell behandelten Patienten gleich gut abschnitten.
Ebenfalls eine große Beobachtungsstudie mit über 6000 Patienten wurde von Spence et al. in der Homöopathie-Ambulanz des Universitätsklinikums Bristol, England, ausgeführt (Ref. 15 bei Teut)[17], und erbrachte angeblich hervorragende Ergebnisse. Was will man auch anders erwarten, wenn es keine Vergleichsgruppe gibt und die behandelnden Homöopathen die Ergebnisse mit den Patienten gemeinsam ermittelten. Man kann sich ja einmal überlegen, was mit den Arbeitsplätzen der Therapeuten geschehen wäre, wenn diese Studie keine positiven Ergebnisse erbracht hätte.
Wassenhoven et al. (Ref. 17 bei Teut) [18] fanden in ihrer Beobachtungsstudie ohne Vergleichsgruppe an 772 Kindern tatsächlich eine Zunahme von Lebensqualität (allerdings nur um 3 bis 10 von 100 Indexpunkten) und eine hohe Zufriedenheit der Eltern, was nicht sehr viel über den Erfolg der Behandlung aussagt, wenn man davon ausgeht, dass die Eltern sicher jede positive Änderung im Befinden der Kinder der Wirksamkeit des Mittels zugeschrieben haben dürften. Allerdings sind Teuts Angaben nicht zutreffend, dass nur 4,2 % der Kinder Nebenwirkungen aufzeigten: Nach den Studienangaben traten zwar in diesem Anteil Nebenwirkungen auf, die die Eltern auf die Homöopathie zurückführten, allerdings gab es bei 10,1 % der Fälle signifikante Erstverschlechterungen („significant aggravations“) und in 19 % leichte („slight aggravation of symptoms“).
Dass sich bei der Behandlung von Neurodermitis nach 12, 24 und 36 Monaten unter homöopathischer Behandlung die gleichen Ergebnisse zeigten wie in der konventionell behandelten Vergleichsgruppe, ist in den an der Berliner Charité durchgeführten Untersuchungen immer des gleichen Teams um Claudia Witt (Ref 18, 19 und 20 bei Teut) auch nicht weiter verwunderlich: Wenn man die entsprechende Tabelle zu den Behandlungen heranzieht, dann gab es zumindest im letzten Jahr der Beobachtung praktisch keinen Therapieunterschied [19]:
Es wurden eingesetzt (jeweils % der Patienten):
Corticosteroide: Homöopathie 9,5 %, Konventionell 10,2 %
Antihistamine: Homöopathie 1,3 %, Konventionell 4 %
Grundlegende Hautpflege („basic skin care“): Homöopathie 66,9 %, Konventionell: 61,0 %
(keine weiteren Angaben zur Therapie).
In der Beobachtungsstudie von Rostock et al. (Ref 21 bei Teut) [10] zeigte sich tatsächlich eine höhere Lebensqualität bei homöopathisch behandelten Krebspatienten als in der konventionell therapierten Vergleichsgruppe. Allerdings bestand die Homöopathiegruppe zu einem großen Teil aus Patienten einer teuren Privatklinik, während die Vergleichsgruppe vielfach aus Patienten eines Kreisklinikums bestand. Bei Studienbeginn lag bei letzteren die Erstdiagnose drei Monate zurück, bei den Homöopathiepatienten hingegen neun Monate. Wäre es da verwunderlich, wenn die Lebensqualität für die Homöopathiepatienten tatsächlich besser gewesen wäre? Deshalb im Konjunktiv gefragt, denn wenn man die Rechenfehler korrigiert, die den Autoren offenbar unterlaufen sind, und die Daten bezogen auf die Erstdiagnose und nicht auf Studienbeginn miteinander vergleicht, dann verschwindet dieser Vorteil (Details siehe hier).
In der Studie von Frass et al. (ref. 24 bei Teut) [11], wurden die Krebspatienten tatsächlich randomisiert, was für eine vergleichbare Ausgangslage sorgt, insbesondere wenn die Zahl der Patienten, wie in diesem Fall, sehr hoch ist. Die Homöopathiepatienten erhielten zusätzlich zu ihrer konventionellen Krebstherapie noch Homöopathika, die Vergleichsgruppe erhielt keine zusätzlichen Mittel, noch nicht einmal Placebo. Auf der einen Seite kümmert sich ein mitfühlender Homöopath regelmäßig um den Patienten, der eine zusätzlichen Therapie erhält, auf der anderen Seite geschieht nichts dergleichen. Ist es da ein Wunder, dass erstere ihre Lebensqualität subjektiv besser bewerten?
Teuts Angabe, unter homöopathischer Behandlung hätten sich in einer Beobachtungsstudie von Walach et al. (ref. 28 bei Teut) [20] klinisch relevante Verbesserungen bei Kopfschmerzen ergeben, ist nicht nachzuvollziehen. Walach schreibt selbst in der Zusammenfassung der Arbeit, die im Anschluss an eine placebokontrollierte und randomisierte Vergleichsstudie („Münchner Kopfschmerzstudie“) durchgeführt wurde:
„Es konnten keine auf die Behandlungen zurückzuführenden Unterschiede in den Wirkungen erkannt werden. Die Patienten ohne Therapie zeigten auch ein Jahr nach der Studie die größten Verbesserungen. … Es gibt keine Anzeichen einer spezifischen oder verzögerten Wirkung der Homöopathie.“ (Übersetzung von mir)
Wie deutlich müssen die Autoren eigentlich noch hinschreiben, dass sich die homöopathische Behandlung nicht von Placebo unterschieden hat, diesem sogar eher unterlegen war, damit diese Studie nicht als positives Ergebnis angeführt wird?
Lassen wir es bei diesem Blick auf die im Forschungsreader zitierten Arbeiten bewenden. Das Problem ist, dass eine Gegenhaltung immer länger ist als die ursprüngliche Behauptung. Da man Kritik natürlich immer begründen sollte, damit sie ernst genommen werden kann, würde die Auseinandersetzung mit allen dreißig Studien sehr umfangreich werden. Ich will nicht behaupten, dass alle anderen Studien, die hier nicht aufgezählt wurden, hinsichtlich der Fragwürdigkeit der Methodik gleich zu beurteilen wären, aber dieser kurze Einblick mag genügen um zu zeigen, dass die im Reader zitierten Belege für eine Wirksamkeit der Homöopathie als Ganzes nicht belastbar sind. Gerade das letzte Beispiel, wo man sich im Forschungsreader glatt über die Ergebnisse der Studie hinwegsetzt, dürfte die mangelnde Belastbarkeit der Angaben hinreichend illustrieren.
Quintessenz: Die homöopathischen Beobachtungsstudien liefern auch keine Hinweise, dass die Homöopathie erfolgreich sein könnte – egal unter welcher Überschrift man sie zusammenfasst.
Quellen:
[1] Balzer V, Rahmlow A.: „Globuli zeigen doch Wirkung“, Radiosendung Deutschlandradio Kultur vom 07.03.2017 (Link)
[2] WissHom (Hrsg.): Der aktuelle Stand der Forschung zur Homöopathie, Köthen (Anhalt), 2016, Link
[3] Teut M: Versorgungsforschung zur Homöopathie, enthalten in [2], S. 7-12
[4] Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema versorgungsforschung, abgerufen 17.04.2017 (Link)
[5] NN: Projektdatenbank Versorgungsforschung Deutschland, Webseite Deutsches Netzwerk Versiorgungsforschung e.V., abgerufen 17.04.2017 (Link)
[6] Beispielprojekt aus [5]: (Link)
[7] Beispielprojekt aus [5]: (Link)
[8] Beispielprojekt aus [5]: (Link)
[9] Haidvogl M, Riley DS, Heger M, Biren S et al.: Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting, BMC Complementary and Alternative Medicine (2007);7:7 Link
[10] Rostock M, Naumann J, Guethlin C, Guenther G, Bartsch HH, Walach H. Classical Homeopathy in the treatment of cancer patients – a prospective observational study of two independent cohorts. BMC Cancer 2011, 11:19, Link zum Volltext
[11] Frass M, Friehs H, Thallinger C et al.: Influence of adjunktive classical homeopathy on global health status on subjective wellbeing in cancer patients – a pragmatic randomized controlled trial, Complementary Therapies in medicine (2015),23(3), 209-317, Link
[12] Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, Clausen J, Moss S, Davidson JRT, Ford I: Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis, Systematic Reviews (2014) 3:142, Link
[13] Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN: Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public Health (2005), 5(1), 115. Link zum Volltext
[14]Bajic C.: Wobei kann Homöopathie helfen? Angaben auf der Praxishomepage, abgerufen am 17.04.2017 (Link)
[15] Aust N.: In Sachen Homöopathie – eine Beseisaufnahme, durchgesehene Neuauflage, 1-2-Buch.de, Ebersdorf, 2014, S. 212
[16] Lüdtke R, Willich SN, Ostermann T: Are the effects of homeopathy attributable to a statistical artefact? A reanalysis of an observational study, Evd Based Complement Alternat Med (2013), Link zum Volltext
[17] Spence D S, Thompson EA, Barron SJ: Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year, university-hospital outpatient observational study. Journal of Alternative & Complementary Medicine (2005), 11(5), 793-798, Link zum Volltext
[18] Van Wassenhoven M, Goossens M, Anelli M, Sermeus G et al.: Pediatric homeopathy: A prospective observational survey based on parent proxy-reports of their children’s health-related Quality of Life in six European countries and Brazil. Homeopathy (2014), 103(4), 257-263, Link zum Abstract
[19] Roll S, Reinhold T, Pach D, Brinkhaus B et al.: Comparative effectiveness of homoeopathic vs. conventional therapy in usual care of atopic eczema in children: long-term medical and economic outcomes. PloS one (2013), 8(1), e54973. Link zum Volltext
[20] Walach H, Lowes T, Mussbach D, Schamell U et al.: The long-term effects of homeopathic treatment of chronic headaches: one year follow-up and single case time series analysis. British Homoeopathic Journal (2001), 90(2), 63-72. Link zum Abstract

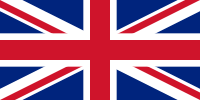






Pingback: Homöopathie: Behnkes kalter Morgenkaffee im Fakten-Check | gwup | die skeptiker
Pingback: Homöopathie – Nichts ist teurer als weniger | Ganzheitlich Durchleuchtet
Pingback: Homöopathie – das rote Tuch @ gwup | die skeptiker
Insgesamt eine ganz richtige Einordnung der Homöopathiestudien, aber trotzdem zwei kritische Anmerkungen:
1. Man sollte die Abgrenzung der Versorgungsforschung gegenüber der Nutzen- und Wirksamkeitsfrage nicht zu eng ziehen. Letztlich ist der Patientennutzen die Leitfrage der Versorgungsforschung, bei allen Unterschieden gegenüber Wirksamkeitsstudien unter Idealbedingungen (Stichwort effectiveness versus efficacy).
2. Die Formulierung, der Einfluss der sozialen Lage auf die Wirksamkeit bzw. allgemeiner den Nutzen von Therapien sei „wohl eher belanglos“ ist mehr als unglücklich. Die soziale Lage stellt vielmehr auch bei Therapieeffekten einen ganz zentralen Einflussfaktor dar. Studien, die das außer acht lassen, z.B. naive Vergleiche zwischen Patienten in homöopathisch orientierten Privatkliniken und Allgemeinkrankenhäusern, sind wertlos.
Das Ärgerliche an der Homöopathie ist, neben der von Dir wieder einmal sehr gut herausgestellten kritiklosen Bezugnahme auf Studien abgründiger Qualität, dass sie immer wieder die Frage der spezifischen Wirksamkeit von Homöopathika und der Wirksamkeit von Kontextfaktoren systematisch vermischt und so den Eindruck erweckt, als müsse der Patient Zucker zum Gespräch bekommen.
Moin
Danke, so müßte es doch jetzt jeder verstehen….